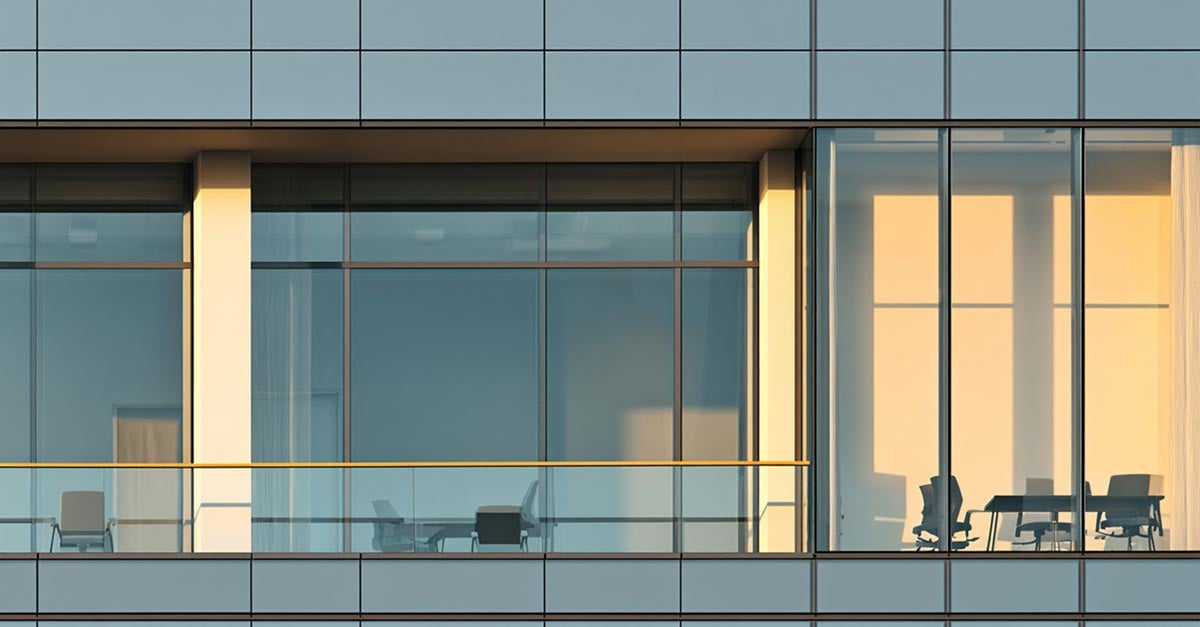
In seinem Bericht vom 18. Juni 2025 gab der Rat der EU bekannt, dass der Vorschlag der „ATAD III-Richtlinie“ („Unshell-Richtlinie“) nicht weiterverfolgt wird. Ziel dieser Richtlinie war es, die missbräuchliche Nutzung von Briefkastenfirmen und substanzarmen Gesellschaften für Steuervermeidungszwecke zu unterbinden. Obgleich der Gedanke nachvollziehbar erscheint, war die angestrebte Regelung überaus komplex, praxisfern und vielfach überschießend ausgestaltet. Zudem war fraglich, wie sie sich in das bereits bestehende Geflecht an Substanzanforderungen im nationalen und internationalen Steuerrecht eingliedert.
Neben ganz herkömmlichen Strukturen hätte der Richtlinienentwurf insbesondere auch Private Equity Strukturen ins Visier genommen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Diskussion eine Fortsetzung finden wird, weswegen bestehende In- und Outbound Investment-Strukturen auf den Prüfstand gestellt werden sollten.
Hintergrund der ATAD-Initiative
Die Anti Tax Avoidance Directives („ATAD“) stellen zentrale Instrumente der EU zur Bekämpfung von Steuervermeidung und zur Harmonisierung steuerlicher Standards dar und sind eng mit dem BEPS-Projekt der OECD verknüpft, das auf die Stärkung der globalen steuerlichen Integrität und Transparenz abzielt.
Im Rahmen eines umfassenden Aktionsplans zur Bekämpfung von Steuervermeidung legte die Europäische Kommission zunächst die ATAD I-Richtlinie vor, welche grundlegende Vorschriften zur Zinsschranke, zur Wegzugsbesteuerung, zur Hinzurechnungsbesteuerung sowie eine allgemeine Missbrauchsvermeidungsklausel enthält, die auf die Verhinderung künstlicher Gestaltungen ohne wirtschaftliche Substanz abzielt. Die ATAD II ergänzt diese Regelungen um spezifische Bestimmungen zu hybriden Gestaltungen, insbesondere solche zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten. Ziel ist es, steuerliche Inkongruenzen zu beseitigen, die durch unterschiedliche rechtliche und steuerliche Bewertungen von Finanzinstrumenten und Rechtsträgern entstehen.
Umsetzung der ATAD I und II Richtlinien in nationales Recht
Die Umsetzung der ATAD I und II in deutsches Recht erfolgte mit Wirkung zum 1. Januar 2022. Mit dem ATAD-Umsetzungsgesetz wurden u. a.
- der § 4k EStG zur Vermeidung hybrider Gestaltungen,
- eine Anpassung der Zinsschrankenregelung in § 4h EStG,
- eine Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7 - 14 AStG) und
- eine Neuregelung der Wegzugsbesteuerung (§ 6 AStG)
eingeführt. Ziel der Gesetzesinitiative war es, die europarechtlichen Vorgaben effektiv und praxisgerecht in das nationale Steuerrecht zu integrieren und damit grenzüberschreitende Steuervermeidungsstrategien einzudämmen.
ATAD III – Hintergrund und Inhalt
Mit der ATAD III („Unshell-Richtlinie“) beabsichtigte die Europäische Kommission, die bestehenden Regelungen der ATAD weiter auszubauen. Der Richtlinienvorschlag vom 22. Dezember 2021 sah die Einführung von Kriterien zur Identifikation von Unternehmen mit geringer wirtschaftlicher Substanz vor. Ziel war es, die missbräuchliche Nutzung solcher substanzlosen Gesellschaften – insbesondere sogenannter Briefkastengesellschaften – als Vehikel zur Steuervermeidung zu unterbinden.
In den Anwendungsbereich dieser Vorschrift fielen dabei insbesondere auch klassische Strukturen im Private Equity-Sektor. Die Einstufung als substanzloses Unternehmen sollte anhand folgender kumulativer, also gleichzeitig vorliegender, Kriterien erfolgen:
- Mehr als 65 Prozent der Einkünfte stammen aus „relevanten Einkünften“, wie Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren oder Immobilienerträgen;
- Mehr als 55 Prozent des Buchwerts der Vermögenswerte waren in den beiden vorangegangenen Steuerjahren außerhalb des Sitzstaates belegen oder mindestens 60 Prozent der relevanten Einkünfte wurden grenzüberschreitend erzielt oder ausgezahlt;
- Auslagerung der Verwaltung des operativen Tagesgeschäfts und der strategischen Unternehmensführung.
Die Erfüllung dieser Kriterien hätte umfangreiche Offenlegungs- und Berichtspflichten im Rahmen der Steuererklärung ausgelöst. Unternehmen hätten unter anderem Angaben zur Existenz eigener Geschäftsräume, eines aktiven Bankkontos sowie zur Beschäftigung von Arbeitnehmern und zur Geschäftsführung am Unternehmenssitz machen müssen.
Sofern die Mindestsubstanzanforderungen nicht erfüllt worden wären, hätte dies – unabhängig vom konkreten Geschäftsmodell – zur Vermutung einer fehlenden wirtschaftlichen Substanz geführt und damit den Anwendungsbereich der ATAD III eröffnet. Unternehmen hätten sodann die Möglichkeit zu einem detailliert zu führenden Gegenbeweis gemäß Artikel 9 des Richtlinienentwurfs erhalten. Die Konsequenzen einer fehlenden Substanz hätten unter anderem in einem steuerlichen Zugriff auf die Anteilseigner oder der Versagung von Quellensteuerermäßigungen bestehen können.
Kritik, aktueller Stand und Ausblick
Der Entwurf der ATAD III-Richtlinie wurde seit seiner Veröffentlichung intensiv kritisiert. Insbesondere wurde bemängelt, dass die vorgesehenen Regelungen keine Rücksicht auf die tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit eines Unternehmens nehmen. Während nationale Vorschriften wie § 50d Abs. 3 EStG und § 8 Abs. 2 AStG eine funktionsbezogene Betrachtung vorsehen und die wirtschaftliche Aktivität in den Mittelpunkt stellen, knüpfte die ATAD III ausschließlich an formale Substanzkriterien an.
Dies hätte zur Folge gehabt, dass steuerliche Konsequenzen entweder vollständig eintreten oder gänzlich ausbleiben – unabhängig vom Geschäftsmodell oder der tatsächlichen Geschäftstätigkeit. Zudem wurden Überschneidungen mit der DAC6-Richtlinie zur Bekämpfung aggressiver Steuerplanungen festgestellt.
Diese inhaltlichen Redundanzen sowie Zweifel an der praktischen Umsetzbarkeit führten letztlich dazu, dass die EU-Kommission den Richtlinienvorschlag nicht weiterverfolgt.
Der ECOFIN-Rat bestätigte dies in seinem Bericht vom 18. Juni 2025 (Dok.-Nr. 9960/25).
Gleichwohl besteht das Ziel der Bekämpfung missbräuchlicher Strukturen weiterhin. Es bleibt möglich, dass einzelne Elemente der ATAD III künftig in die DAC6-Richtlinie integriert und dort umgesetzt werden.
Was bedeutet das für Private Equity Unternehmen?
Obgleich das Aus für den Richtlinienentwurf positiv zu bewerten ist, sollten bestehende Strukturen (in- und outbound) auf den Prüfstand gestellt werden. Die Thematik ist aktueller denn je und eine Fortsetzung der Diskussion ist nicht ausgeschlossen.
Wir unterstützen Sie gerne bei der steuerrechtlichen Bewertung und Optimierung Ihrer bestehenden Struktur. Kontaktieren Sie unser Expertenteam für eine individuelle Beratung zu ATAD, DAC6 und internationalen Steuerstrukturen.
Gestalten Sie Ihren individuellen Informationsbedarf: Abonnieren Sie hier unsere kostenlosen Newsletter.

