Digitale Plattformen

Digitale Plattformen sind die neue Infrastruktur der Wirtschaft
Sie vernetzen nicht nur Menschen und Märkte – sondern auch Daten, Geschäftsmodelle und regulatorische Anforderungen. Ob Green IT, Generative KI oder digitale Identitäten im globalen Handel: Digitale Plattformen sind längst mehr als technische Infrastruktur – sie sind das Fundament für wirtschaftliche Skalierung, nachhaltige Wirkung und echte Transformation.
Damit aus Technologie eine Plattform wird, braucht es mehr als Code:
Sie muss verbinden, was getrennt ist. Vertrauen schaffen, wo Misstrauen herrscht. Und skalieren, wenn es darauf ankommt.
Drei Prinzipien machen das möglich:
Vernetzbar. Anschlussfähig. Offen.
Plattformen entfalten erst dann Wirkung, wenn Daten, Systeme und Partner reibungslos zusammenspielen – über standardisierte Schnittstellen und Formate.
Sicher. Kontrollierbar. Nachvollziehbar.
Vertrauen entsteht durch klare Rollen, digitale Identitäten und transparente Regeln – gerade bei sensiblen Daten oder regulatorischen Anforderungen.
Wachstumsfähig. Nutzbringend. Zukunftssicher.
Plattformen müssen mit jeder Nutzung besser werden – durch datenbasierte Services, Automatisierung und steigende Netzwerkeffekte.
Was sind digitale Plattformen?
Digitale Plattformen sind mehr als nur smarte Tools – sie sind das digitale Rückgrat moderner Wirtschaft. Sie verbinden das, was früher in Silos gedacht wurde: Daten, Prozesse, Partner, ganze Geschäftsmodelle.
Das Entscheidende: Plattformen bieten nicht nur eigene Services an, sondern ermöglichen anderen, ihre Angebote darüber zu verbinden, zu skalieren und weiterzuentwickeln – sei es im Handel, in der Verwaltung oder entlang komplexer Lieferketten.
Plattformen sind nicht das Ende der Digitalisierung – sie sind der Anfang echter Verbindung.
Die 6 größten Herausforderungen auf dem Weg zur Plattformfähigkeit
Plattformen schaffen einheitliche Standards – damit alle auf derselben Basis entscheiden können.
Digitale Identitäten und klare Governance schaffen Sicherheit – und die Basis für Zusammenarbeit über System- und Unternehmensgrenzen hinweg.
Plattformen entfalten ihre Wirkung nur, wenn Daten und Prozesse nahtlos zusammenspielen – interoperable Strukturen machen den Unterschied.
Plattformen sind skalierbar von Anfang an – sie tragen Wachstum, ohne Komplexität zu erzeugen.
Erst mit einem klaren Plattformverständnis entstehen Orientierung, Priorisierung und wirtschaftlicher Nutzen.
Plattformlogik vernetzt Systeme, Teams und Geschäftsbereiche – und bringt Struktur in verteilte Digitalisierung.
Wie digitale Plattformen wirtschaftliche Wirkung entfalten
Mehr Insights




Wie plattformfähig ist Ihr Unternehmen?
Plattformen entfalten ihren Mehrwert nur, wenn Strategie, Struktur und Technologie zusammenspielen. Diese sechs Fragen helfen, den eigenen Reifegrad einzuordnen – und Potenziale zu erkennen.
Ohne eine klare Datenstrategie bleibt Plattformdenken oft Stückwerk. Wenn Daten in Silos liegen oder uneinheitlich gepflegt werden, fehlt die Basis für skalierbare Plattformansätze.
Fragen Sie sich: Gibt es ein gemeinsames Verständnis, welche Daten wo entstehen – und wie sie genutzt werden?
Ob Kundenportal, Lieferantennetzwerk oder öffentliche Schnittstelle – Plattformen leben von Anschlussfähigkeit. Wenn Sie neue Partner erst „einbauen“ müssen, statt sie einfach zu integrieren, geht Zeit und Skalierungspotenzial verloren.
Viele Unternehmen starten Plattformvorhaben – verlieren aber unterwegs Struktur und Fokus. Wenn nicht klar ist, wer Entscheidungen trifft, wer für Daten, Schnittstellen oder Standards verantwortlich ist, entstehen Reibungsverluste statt Fortschritt.
Plattformen sind keine isolierten Systeme. Wer heute Interoperabilität mitdenkt – über APIs, gemeinsame Datenmodelle oder semantische Standards – hat morgen einen echten Vorsprung bei Integration und Skalierung.
Vertrauen ist die Basis jeder Plattform. Wenn Sie nicht eindeutig steuern können, wer worauf zugreift – intern wie extern – blockieren sich Potenziale. Digitale Identitäten, Rollenmodelle und dezentrale Vertrauensmechanismen schaffen Sicherheit und Transparenz.
Plattformen lohnen sich nur, wenn sie Wirkung entfalten – sei es durch neue Erlösmodelle, Effizienzgewinne oder ESG-Beiträge. Können Sie heute beziffern, welchen konkreten Mehrwert Ihre Plattformstrategie schafft?
Ob B2B, B2C oder D2C – Jede Plattform birgt umsatzsteuerliche Themenstellungen. Eine frühzeitige Analyse Ihres Geschäftsmodells hebt Ihre Plattform auf das nächste Level.
Viele Unternehmen sind auf dem Weg – aber nicht alle kennen ihr Ziel.
Wir helfen dabei, Plattformfähigkeit systematisch und praxisnah zu entwickeln.



Wir sind ausgezeichnet.






Vier Plattformbeispiele, die Wirkung entfalten
Plattformfähigkeit zeigt sich nicht nur in der Theorie – sondern dort, wo sie echte Wirkung entfaltet: in konkreten Anwendungen, Märkten und Technologien.
Diese vier Plattformbeispiele veranschaulichen, wie Unternehmen weltweit digitale Infrastrukturen nutzen, um Prozesse zu vernetzen, Wertschöpfung neu zu denken und regulatorische Anforderungen innovativ zu lösen.

TWIN – Trade Worldwide Information Network
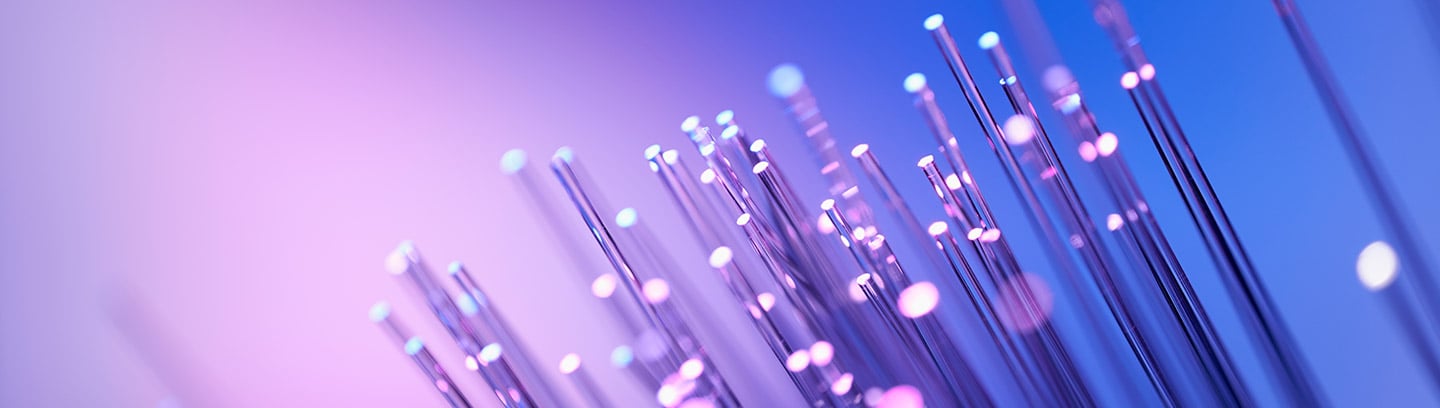
Azure OpenAI Service

Gaia-X

Siemens Xcelerator
Was heißt das für Ihr Unternehmen?
Ob Daten, Prozesse oder Geschäftsmodelle – Plattformlogik schafft Strukturen, die wachsen können. Die gezeigten Beispiele sind nur ein Ausschnitt. Die Möglichkeiten sind vielfältig – entscheidend ist:
Wo beginnen Sie?
Diese Themen ergänzen Ihre Plattformstrategie
Gestalten Sie Ihren individuellen Informationsbedarf: Abonnieren Sie hier unsere kostenlosen Newsletter.
Begriffe rund um digitale Plattformen – einfach erklärt
Eine digitale Plattform ist ein technisches System, das verschiedene Akteure – wie Unternehmen, Partner oder Kund:innen – über standardisierte Schnittstellen miteinander verbindet, um Daten, Leistungen oder Prozesse effizient auszutauschen.
Plattformfähig ist ein Unternehmen, wenn seine Strukturen, Systeme und Prozesse so aufgestellt sind, dass sie offen, vernetzbar und skalierbar sind – also digitale Plattformlogik ermöglichen.
Interoperabilität bezeichnet die Fähigkeit verschiedener Systeme, Daten und Prozesse nahtlos miteinander zu kommunizieren – intern und extern, technisch wie organisatorisch.
Self-Sovereign Identity ist ein Konzept für digitale Identitäten, bei dem Nutzer:innen selbst kontrollieren, welche Daten sie wann und mit wem teilen – ohne zentrale Zwischenspeicher.
Digitale Governance regelt, wie Plattformen gesteuert werden: Wer darf was? Welche Daten gelten als vertrauenswürdig? Und wie werden Zugriffe, Rollen und Standards verwaltet?
Eine API (Application Programming Interface) ist eine digitale Schnittstelle, über die Systeme miteinander kommunizieren. Sie ermöglicht es, Services und Daten flexibel zu integrieren – ein zentraler Baustein jeder Plattform.
Ein digitales Ökosystem entsteht, wenn mehrere Partner – z. B. Unternehmen, Entwickler oder Behörden – gemeinsam auf einer Plattform agieren, sich ergänzen und voneinander profitieren.
Ein Netzwerkeffekt entsteht, wenn eine Plattform mit jeder neuen Teilnahme wertvoller wird – weil mehr Daten, Services oder Nutzer:innen eingebunden sind.
Ein Datenraum ist ein geschütztes, interoperables digitales Umfeld, in dem Organisationen Daten sicher austauschen können – auf Basis gemeinsamer Standards, Verträge und Governance-Regeln.
Beispiel: Die europäischen Initiativen wie Gaia-X oder Catena-X nutzen Datenräume für vertrauensvollen Datenaustausch zwischen Partnern.
DLT steht für Distributed Ledger Technology – also eine verteilte Datenbank, bei der Transaktionen dezentral gespeichert und synchronisiert werden.
Diese Technologie wird häufig in Plattformen genutzt, um Vertrauen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit ohne zentrale Instanz zu ermöglichen (z. B. bei digitalen Identitäten, Herkunftsnachweisen oder Smart Contracts).
Plattformökonomie beschreibt ein Wirtschaftsmodell, bei dem Plattformen als Vermittler zwischen verschiedenen Nutzergruppen agieren – etwa zwischen Anbietern und Nachfragern.
Der Plattformbetreiber stellt die Infrastruktur, Regeln und Schnittstellen bereit – der eigentliche Mehrwert entsteht durch die Interaktion der Teilnehmer.